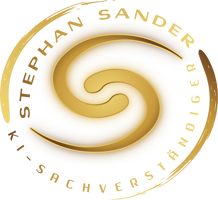Räsonnement

Was können wir wissen? – Beziehen wir die kantische Frage auf das dynamische Spektrum der künstlichen Intelligenz, scheinen selbst Experten nicht wirklich wissend zu sein. Zwar dürfen wir als »Wissensgesellschaft« in einer anschwellenden Informationsflut schwimmen. Doch die Fähigkeit Irrelevantes ignorieren zu können, erscheint zunehmend wichtiger.
Ein Großteil unseres vermeidlichen Wissens ist offenkundig nicht mehr analytischer, sondern vielmehr synthetischer Natur: allzu häufig bleiben wir auf Meinungen, Interpretationen und Beurteilungen anderer angewiesen. Hinzu gesellt sich beschränkte algorithmische Deutung künstlicher Intelligenzen. In Anbetracht abnehmender Substanz wird somit kritisches Hinterfragen künftig obligatorisch sein.
Beim Thema »künstliche Intelligenz« existiert eine besonders ausgeprägte Vielfalt an Beurteilungen. Neben Überschätzung einer limitierten Technologie auf kurze Sicht koexistiert Unterschätzung transformativer Effekte auf lange Sicht.
Bei tiefgründigerer Auseinandersetzung offenbart sich, dass der »künstlichen Intelligenz« mit »kritischer Intelligenz« entgegenzutreten ist. Im Resultat einer Reflexion über die scheinbar notwendige Revolution eröffnet sich ein Räsonnementvernünftige Überlegung, Vernunftschluss, das überzeichnete Aspekte zu balancieren vermag. Schlüssel zur rechten Beleuchtung von Applikation hochmoderner Technik liegen etwa in der Grundfrage antiker Ethik: “Was zeichnet ein gutes Leben aus?”

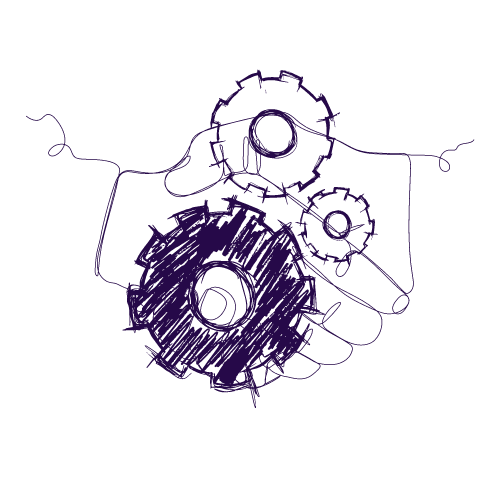
Spezifischer befassen sich Personal- und Betriebsräte heute mit der Frage: “Was zeichnet gute Arbeit aus?”
Grundlage zur Wahrung individueller Rechte und Fairness sind auch hier ethische Überlegungen zur Gerechtigkeit. Entsprechend geht es auch beim Thema KI vorrangig um komplementäre Teilhabe anstelle unsozialer Substitution. Denn nur ein genuin menschenzentrierter Einsatz von KI bringt uns näher an Bertrand Russels Vision von weniger Arbeit mit mehr Sinn.